Philippe Jaccottets Spätwerk „Die wenigen Geräusche“, vorgestellt von Daniele Dell‘Agli
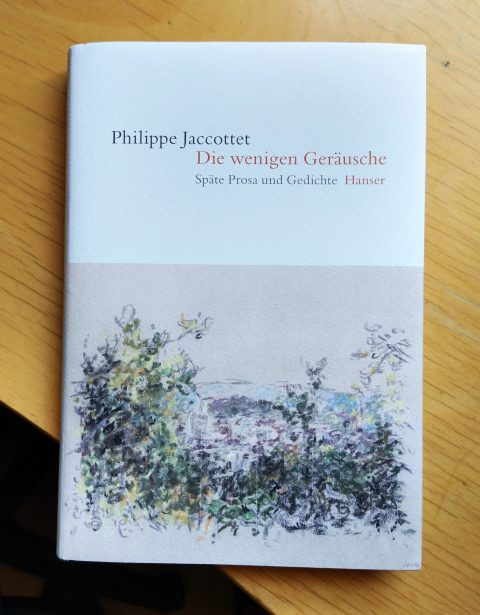
Philippe Jaccottet, geboren am 6. August 1925, gehört zu den letzten großen Autoren des 20. Jahrhunderts, mit denen sich eine eigene Poetik, ja ein poetischer Kosmos verbindet. Lange Zeit als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt, in Frankreich mittlerweile durch eine Pléjade-Edition zum Klassiker geadelt, ist er in Deutschland nach wie vor nur wenigen Liebhabern der französischen Moderne bekannt, obwohl nahezu sein gesamtes Werk in deutscher Übersetzung vorliegt.
Der jetzt bei Hanser erschienene Band „Die wenigen Geräusche“ versammelt Jaccottets letzte, zwischen 2001 und 2008 entstandenen Zyklen. Bereits 2009 hatte der Autor angekündigt, es dabei bewenden zu lassen und schweigend auf das große Unbekannte zu warten, das im hohen Alter unvermeidlich näherrückt.
Dabei hat der gebürtige Schweizer, der seit den 50er Jahren abgeschieden in der Provence lebt, aber als Übersetzer unter anderem von Hölderlin, Rilke und Musil stets im Zentrum des literarischen Lebens wirkte, denkbar leise, weltabgewandte Annäherungen poetischer Sprache an die Geheimnisse der Schöpfung geübt. Darum sollte man unter den „wenigen Geräuschen“, die der Titel des vorliegenden Bandes beschwört, nicht die wenigen im Laufe eines langen Lebens verbliebenen erwarten, sondern die immer schon streng gefilterten, existentiell bedeutsamen Phänomene – das kann ein Eisvogel sein, eine Tagebucheintragung Kafkas oder das Farbenspiel einer Landschaft –, die der Flaneur Jaccottet gleichsam en passant mit behutsamer Geste kurz aufleuchten lässt, ohne sie metaphorisch, symbolisch oder sonst wie bedeutungsheischend aufzuladen. So kommt seine Poetik des Seinlassens – wie Handke sie einst zutreffend lobte – zwar ohne die formalen und stilistischen Herausforderungen moderner Poesie aus; doch die Lektüre seiner zwischen Lyrik, Prosa und Essay, zwischen Beschreibung und Reflexion gleitenden Texte verlangt vom Leser dafür jene intransitivische Offenheit, mit der dieser Autor den Gegenständen seiner Wahrnehmung begegnet.
Wollte man Wahlverwandte für Jaccottets diskreten Weltzugang nennen, so fallen einem unmittelbar nicht die Arbeiten von Kollegen ein, sondern Giorgio Morandis Stilleben (über die Jaccottet Erhellendes geschrieben hat) und Federico Mompous meditative „Musica Callada“ ein.
Alles in allem bietet dieser Band den gelungenen Abschluss eines großen Lebenswerks, in dem man gern wenigstens für die versförmigen Stücke das französische Original konsultiert hätte, das jedoch, wie so oft bei Hanser, für entbehrlich erachtet wurde.
Philippe Jaccottet: Die wenigen Geräusche, übersetzt von Elisabeth Edl u. Wolfgang Matz. Hanser-Verlag 2020, 160 S. 23 Euro.